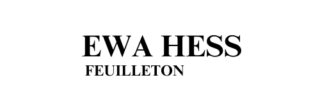Der wahre Vater vom Sennentuntschi
Der wahre Vater vom Sennentuntschi admin | 29. Oktober 2010 – 07:44 VON EWA HESS UND MATTHIAS LERF TEXT UND SEVERIN NOWACKI FOTOS Hansjörg Schneider, junge Schweizer Literatur feiert unerwartete Erfolge. Erstaunt Sie das?Hansjörg Schneider kommt die Holztreppe herunter. Bauernhemd, derbe Schuhe, wacher Blick – der stattliche 72-Jährige könnte ein Wanderurlauber sein, hier im Hotel Engel in Todtnauberg im Schwarzwald. Vor vierzig Jahren hat der Schweizer Erfolgsautor mit seinem Theaterstück «Sennentuntschi» einen Skandal ausgelöst. Einen Tag vor unserem Interview fuhr er nach Basel, um sich Michael Steiners gleichnamigen Film anzusehen, der nächste Woche in die Kinos kommt. Nein. Das ist doch grossartig. Haben Sie die preisgekrönten Bücher gelesen? Das von Elmiger habe ich angefangen. Das von Nadj Abonji noch nicht. Wie hat Ihnen Elmigers Prosa gefallen? Ich bin kein Literaturkritiker. Fühlen Sie sich als Wegbereiter des Schweizer Literaturerfolgs? Warum sollte ich? Elmiger und Abonji sind junge Frauen, die ihre ganz eigene Literatur entwickeln. Das habe ich auch gemacht. Schrieben Sie Ihr «Sennentuntschi» 1969 nicht im Bewusstsein, ein Nachfolger Frischs und Dürrenmatts zu sein? Nein. Ich wollte nichts anderes, als diese Geschichte auf die Bühne stellen. Obschon ich keinen Augenblick damit rechnete, dass sie aufgeführt werden würde. Warum? Weil es eine so verrückte Geschichte ist. Wie fanden Sie Michael Steiners Film «Sennentuntschi»? Insgesamt sackstark. Er ist nicht spurlos an mir vorbeigegangen. Was fanden Sie stark? Die Bilder, vor allem die auf der Alp. Andrea Zogg als Senn ist Weltklasse. Die Geschichte kommt gut durch – dass da die Sennen eine Frau machen, diese ausnüt zen und dann selber drankommen. Gefallen hat mir, dass sie nicht in der hehren Bergwelt spielt. Das ist nicht Eiger, Mönch und Jungfrau, das ist irgendein Seitental, mit Blechdächern, wo keine Sonne hinkommt. Ein paar Dinge fand ich aber schlecht. Was genau? Der Schluss ist verzettelt. Konfus. Dort zerfranst der Film richtig. Und die Musik war mir zu extrem. Ein paarmal habe ich die Ohren zugehalten – und manchmal auch die Augen. Und das Sennentuntschi als Figur hat Ihnen gefallen? Manchmal schon. Manchmal scheint die Darstellerin aber auch nicht zu wissen, was sie spielen soll. Ist sie eine Puppe? Oder ist sie real, ein Mensch? Ja, was ist das Sennentuntschi? Tja, was? In der Sage ist es ein Fantasiegebilde, das brutal in die Realität eingreift. Diese Kraft kommt im Film voll zur Geltung, finster wie eine griechische Tragödie. Die Sage war nicht breit bekannt, bis Sie 1972 Ihr Stück «Sennentuntschi» schrieben. Wie sind Sie auf die Geschichte gestossen? Ich habe mit einem Freund über Frauen geredet, und der war der Meinung, dass vor Frauen nur die Flucht helfe. Als Beweis für seine Theorie erzählte er mir diese Sage. Und ich wusste aufs Mal, drei Männer und eine Puppe, die lebendig wird, das ist Theaterstoff. Vor Frauen hilft nur Flucht? Aber in Ihrem Stück sind doch Männer die Bösewichte. Ja. Auch im Film ist es nicht die Frau, die böse ist. Aber es ist jetzt vierzig Jahre her, seit ich das Stück geschrieben habe. Ich kann es nicht mehr auf der Bühne sehen, ich laufe raus. Ah ja? Warum? Ich mag die brutale Primitivität dieses Stückes nicht mehr, diese Lieblosigkeit. Ihr eigenes Stück ist Ihnen selber zu brutal? Nein, das will ich nicht sagen. Aber ich habe mich in diesen vierzig Jahren verändert. Sind Sie empfindsamer geworden? Das ist möglich. Auf jeden Fall anders. Das Stück ist 1972 in Zürich uraufgeführt worden, aber den grossen Skandal gabs erst 1981 nach der Ausstrahlung der Fernsehversion mit Walo Lüönd. Was war da los? Das Telefon hat pausenlos geläutet! Man hat mich beschimpft, ich habe auch Pakete bekommen – mit Schweinereien darin. Das war mir zu viel, ich bin ins Tessin abgehauen. An der Publikumsdiskussion habe ich nicht teilgenommen, weil ich dachte, danach kennt mich die ganze Schweiz. Was war das Problem? Man empfand es als unanständig. Und die Sprache störte, dass die Sennen «vögle» sagten. Finden Sie in Steiners Film Teile Ihres Stückes wieder? Ja, ich habe vieles wiedererkannt. Michael Steiner sagt ja, er habe mein Stück nicht gesehen. Gelesen hat er es sicher, sonst wäre ja seine Vorbereitung fahrlässig gewesen. Er sagt jetzt, er habe die Sage verfilmt, und die ist frei, juristisch gesehen. Ich muss mal mit dem Verlag sprechen. Könnte der Verlag Ihres Stückes Rechte einklagen? Das weiss ich nicht. Warum haben Sie eigentlich mit dem Schreiben solcher Theaterstücke aufgehört? Ich habe zwanzig Jahre für die Stadttheater geschrieben. Dann war ich nicht mehr gefragt. Da begann ich für Laien zu schreiben. Landschaftstheater, mit Louis Naef und Liliana Heimberg. Das war grossartig. Ein ziemliches Kontrastprogramm. Nicht einmal. Ich lebe zwar in der Stadt, betrachte mich aber nicht als Städter. Ich bin auf dem Land aufgewachsen und komme aus der Bauernwelt. Und Laien sind, wenn sie in ihrem Dialekt spielen, oft authentischer als Profis. Die Kränkung durch das Stadttheater sitzt aber noch tief? Warum vermuten Sie das? Weil man Ihren neuen Krimi «Hunkeler und die Augen des Ödipus» als eine Abrechnung mit der Theaterwelt lesen kann. Ich war ja in Basel am Theater, Regieassistent und Statist. Ich habe Stücke geschrieben. Die ersten fünf hat der Chefdramaturg Hermann Beil alle abgelehnt. Ich habe immer noch eine Wut auf den Herrn. Aber wenn ich ihn sehe, sage ich: Salut Hermann, wie gehts? Im Roman wird über die Schwätzer am Theater gelästert, und vorgeschlagen, man solle doch eher gute Köche staatlich subventionieren, die täten mehr fürs Allgemeinwohl. Ist das Ihre Meinung? Nein! Das Theater ist für mich immer noch etwas vom Besten, das die Menschheit erfunden hat. Ich gehe einfach nicht mehr hin. Wieso? Ich bin zu alt – es interessiert mich nicht mehr so brennend. Aber ich hatte eine ganz tolle Zeit am Theater. Schon in meiner Kindheit. Wir hatten ein grossartiges Kasperlitheater in Zofingen. Das hat mich mitgerissen, und die ganze Kinderschar, ein Geschrei war das. Herrlich. Das Wort «UnterhosenTheater» kommt im neuen Hunkeler auch vor. Spielen Sie damit auf den Theaterskandal um Marthaler in Zürich an? Vielleicht, aber Sie müssen schon unterscheiden, zwischen mir und dem, was in
Der wahre Vater vom Sennentuntschi Read More »