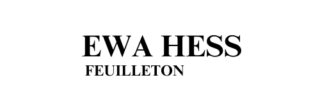Martigny mon amour
Martigny mon amour Ewa Hess | 16. Mai 2013 – 11:54 Die scharfe Frühlingssonne steht Martigny nicht. Unbarmherzig bringt sie die Ungereimtheiten des Ortes zum Vorschein. In den verdunkelten Scheiben von stillos modernen Bürohäusern spiegeln sich malerische Schneegipfel. Das Bahnhofsgebäude aus einem vergangenen Jahrhundert steht verloren zwischen chaotisch angeordneten Parkplatzparzellen. Putzige Ästhetik eines intakten Schweizer Städtchens trifft auf die Zersiedelungsspuren eines aggressiven Baubooms. Valentin Carron entsteigt seinem bequemen Familienauto mit der entspannten Lässigkeit eines Bewohners des amerikanischen Mittleren Westens. So, dass man sofort spürt, wie sehr dieses Auto sein Zuhause ist. Und diese Gegend sein Jagdrevier. Dabei könnte man meinen, der 36-jährige Künstler sei längst seiner Heimatgemeinde entwachsen. Sein Name wird in Paris, New York und London in Grossbuchstaben geschrieben. Er ist der aufstrebende Star der Schweizer Kunst. Geheimnisvoll, eigenwillig, unübersehbar. Vor zwei Jahren verblüffte er die Kunstwelt mit der im Pariser Palais de Tokyo ausgestellten Kunstharz-Replik einer Walliser Weinlaube. In zwei Wochen wird er die Schweiz an der Biennale der Kunst in Venedig vertreten. Doch stur wie ein echter Bergler bleibt Valentin Carron in Martigny wohnhaft. Nur von hier aus, das spürt man, sind diese rätselhaften Skulpturen zu verstehen. Sie nehmen Elemente der Landschaft und ihrer Bebauung auf. Oft sehen sie wie Bergkreuze oder wie Rauverputz-Wände aus. Sie gleichen manchmal den Pergolas, manchmal den Strassenlampen. Doch das ist noch lange nicht das Geheimnis ihrer Wirkung. Ihre Präsenz ist es. Dass sie mit einer archaischen Kraft aufgeladen sind, dem schwarzen Monolith aus Stanley Kubricks berühmten Film «2001: A Space Odyssey» vergleichbar. «Hier, wo ich aufgewachsen bin», setzt Carron zu einer Erklärung an, «komme ich mir vor wie ein Fremder.» So wie er es sagt, muss es etwas Gutes sein. Im Kopf sei er in Zürich, vielleicht in Genf oder Paris zu Hause. Martigny aber sei sein Beobachtungsposten. Denn nur hier gebe es diese Mischung von heimelig und unbehaust, die ein Symptom unserer Zeit sei. Martigny, das sei die westliche Welt in Miniatur. «Nur hier bin ich real», sagt Carron. Ob das ein glücklicher Zustand ist, traut man sich nicht zu fragen. Während wir unseren Allerwelts-Cappuccino im Strassencafé schlürfen, geht schnellen Schrittes Pascal Couchepin mit einem schwarzen Rucksack an uns vorbei. Auch er ein unbeirrbarer Bewohner von Martigny – und sein ehemaliger Bürgermeister. Carron schaut dem Ex-Bundesrat mit einem kleinen Lächeln nach. Es ist ein menschenfreundliches, wenn auch verschmitztes Lächeln. Eine Mischung aus Melancholie und Spott. Noch vor wenigen Jahren wäre es Couchepin gewesen, der den Schweizer Pavillon an der Biennale eröffnet hätte. Wäre das schön, so ein Martigny-Gipfeltreffen in Venedig? Diesmal gilt das spöttische Lächeln der Frage. Diejenigen, die vermutet haben, dass Carron in Venedig etwas besonders Auffälliges inszenieren würde, etwa ein Riesenkreuz, wie 2009 vor dem Eingang zur Art Basel, bleiben auf ihren Erwartungen sitzen. In Valentin Carrons Schweizer Pavillon wird zwar eine 80 Meter lange Schlange die Besucher begrüssen, doch ihr schmaler schmiedeeiserner Körper wird nur dezent den Raum zur Geltung bringen. In Bronze gegossene Musikinstrumente, verbeult, als ob sie schon Generationen von Familienmusikanten gedient hätten, werden die strenge Form des Pavillons brechen. Als Bildelemente installiert der Künstler Remakes von Glasfenstern aus den 50er-Jahren. Er habe viel zu viel Respekt vor der Kunst, sagt Carron, um allzu plakativ auf das Ereignis einer Wettbewerbssituation einzugehen. Stünde dieser Pavillon nicht in den Giardini von Venedig, wohin die ganze Welt guckt, sondern in einem Kunstzentrum in, sagen wir, Portugal, würde er seinen Auftritt auch nicht anders gestalten. Er wolle nur eines: dem schönen, von Albertos Bruder Bruno Giacometti erbauten Pavillon gerecht werden. Seine Form respektieren – und ihr gleichzeitig durch die beharrlich irritierende Form der Werke lautlos widersprechen. Respekt und Widerstand – es ist der gleiche Widerspruch, der bei einem Spaziergang auf dem Friedhof, einem seiner Lieblingsorte, im Blick des Künstlers aufscheint. Wir bleiben bei einem Grab stehen. «Marc Morand – Anwalt und Notar», verkündet die Inschrift, «Bürgermeister von Martigny 1921–1960. Oberst im Generalstab». «Das ist Martigny!», sagt Carron. «Diese Macht, dieser Einfluss, kann man sich das vorstellen?» Hier, auf dem Kirchenacker, inmitten all der Morands, Couchepins, Constantins und auch Gianaddas, merkt man, wie stark die Walliser Vergangenheit in die Gegenwart hineinreicht – die heutigen Patrons tragen die gleichen Namen. Einer von ihnen, der Immobiliengigant Léonard Gianadda, ist im Wallis auch der Chef eines Kunstimperiums. Wenn Martigny eine Miniatur der westlichen Welt ist, dann ist die Fondation Gianadda eine Miniatur von Martigny. Auch hier trifft man auf eine Mixtur nicht zueinanderpassender Elmente: wunderschöne Aussicht, undefinierbares Gebäude und ein Museum, in dem Oldtimer-Autos, gallo-römische Ausgrabungsrelikte und Weltklassekunst leicht windschief nebeneinander existieren. Die Begegnung zwischen Gianadda und Carron muss ein besonderes Spektakel geboten haben – hier der flamboyante Unternehmer und wenig Widerspruch duldende volkstümliche Philanthrop Gianadda, dort der spröde, aber auch ruhig selbstbewusste Kunststar einer intellektuellen Elite. Sie fand jedenfalls statt, diese Begegnung, und resultierte in einem 700 Kilogramm schweren Geschenk – an Martigny. Es ist eine Skulptur in Form einer Aluminiumsäule, viereinhalb Meter hoch, die sich spiralförmig mitten auf der Strasse erhebt und einen Verkehrskreisel in eine archaische Andachtsstätte verwandelt. Wie ein Relikt einer ausgestorbenen Zivilisation wirkt diese Säule, aus der Zeit gefallen, fremd. Die anderen vierzehn Kreisel, die Léonard Gianadda seiner Heimat geschenkt hat, sind wie die meisten Kreisel auf der Welt mit Skulpturen lokaler Grössen ausgestattet, ergänzt durch einen Minotaur Hans Ernis und eine Assemblage Bernhard Luginbühls. «Es war ein Angebot, das man nicht ausschlägt», erklärt Valentin Carron seine Zusage, sich in die Riege der Kreiselkünstler einzureihen, und wir lachen über die Formulierung, die in einen anderen Kontext gehört. Aber er will damit nicht auf Mafiafilme anspielen. Er meint es ernst. Die Anfrage auszuschlagen, wäre ihm feige vorgekommen. Er wollte das gerne machen, für Martigny. Jetzt steht das Werk mitten auf jener Strasse, die nach Fully führt. Dort wurde er geboren. In Fully hatte die Familie des Künstlers ein Cheminée-Geschäft. Hier hat Carron als Kind schon miterlebt, wie am Fusse der majestätischen Walliser Berge Gemütlichkeit als vorfabrizierte Form verkauft wurde. Hier schulte sich sein Auge für die falsche Authentizität und für authentische Künstlichkeit. Jetzt wird er diese Sensibilität für
Martigny mon amour Read More »