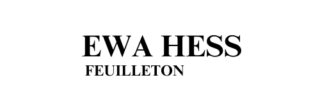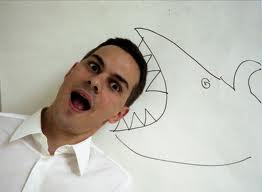Sam Keller über «seinen» Cattelan
Sam Keller über «seinen» Cattelan Ewa Hess | 10. Juni 2013 – 10:40 «Stecken sie in der Wand fest oder wollen sie mit dem Kopf hindurch?» antwortet mir Sam Keller mit einer Frage nach seiner Interpretation des neuen Kunstwerks von Maurizio Cattelan, das er in der Fondation Beyeler ausstellt. Als ich ihn treffe einige Tage vor dem Beginn der Art Basel, eilt der wundersame Fundation-Beyeler-Chef und Art-Basel-Präsidentdurch die Räume seines Museums in Riehen. Als sich zuhinterst die Pferdeskulptur von Maurizio Cattelan offenbart, leuchten seine Augen auf. Mit 46 Jahren ist der Direktor der Fondation Beyeler und Präsident der Art Basel eine der einflussreichsten Persönlichkeiten der internationalen Kunstwelt. Sechs Jahre unter der Leitung des von Ernst Beyeler persönlich ausgewählten quirligen Chefs verwandelten die edle Fondation in ein pulsierendes Weltmuseum. Zur Eröffnung der Art Basel bietet Keller eine Sensation an: Ein neues Werk des Kunststars Maurizio Cattelan, dessen Ankündigung, sich von der Kunst zurückzuziehen, für Schlagzeilen gesorgt hat. Sam Keller, war es schwierig, Maurizio Cattelan zu überzeugen, trotz seinem Rückzug doch in der Fondation Beyeler auszustellen? Nein, eigentlich nicht. Wir arbeiten ja schon vor seiner Retrospektive im Guggenheim daran. Als ich von seinen Rückzugsplänen erfuhr, war ich verunsichert. Doch noch an der Eröffnung in New York sagte mir der Künstler, dass er unser Projekt weiterhin verwirklichen möchte. Im Vorfeld der Ausstellung ist spekuliert worden, was genau in der Fondation Beyeler gezeigt wird. War es von Anfang an klar, dass es die fünffache Pferdeskulptur sein wird? Nein, zunächst war das Projekt klein angedacht. Danach gab es verschiedene Phasen, und tatsächlich war eins der möglichen Projekte die schwere Skulptur, über die spekuliert wurde. Wir haben Abklärungen getroffen, wie wir diese ins Museum reinkriegen, die dann publik wurden. Doch dann hatte Cattelan den Geistesblitz mit den Pferden. Was steht hinter der Idee? Eine der berühmtesten Arbeiten von Cattelan ist sein Pferd. Seine Idee war es, alle fünf Versionen dieser Arbeit von 2007 erstmals zusammenzubringen und als neue Werkgruppe zu zeigen. In Cattelans Werk spielen ausgestopfte Tiere eine wichtige Rolle: Tauben, Eichhörnchen, Esel oder Elefant. Und Pferde, auf die wir menschliche Eigenschaften projizieren. Hat diese Skulptur auch Provokation vorprogrammiert? Diese gehört bei Cattelan dazu, allerdings mit Tiefsinn. Seine Werke sind verführerisch und verstörend zugleich. Wie in Träumen. Gerade diese surreale Qualität macht die Stärke seiner Kunst aus. Sie stellt mehr Fragen, als dass sie Antworten gibt. Welche Fragen konkret? Wer sind diese Kreaturen, und warum haben sie den Kopf verloren? Stecken sie in der Wand fest oder wollen sie mit dem Kopf hindurch? Wollen sie fliehen oder in einen anderen Raum vordringen? Wird sich Cattelan tatsächlich von der Kunst zurückziehen? Maurizio Cattelan ist ein wahrer Künstler – einer der interessantesten unserer Zeit. Und man kann das Künstlersein nicht einfach so abstellen. Warum will er überhaupt aufhören? Er hat mir mal erklärt, dass er diese Entscheidung während der Vorbereitung seiner Retrospektive getroffen hat. Eine Schau sämtlicher Werke ist immer eine Art Bilanz, also auch ein Abschluss. Und wenn ein Künstler so berühmt und erfolgreich ist wie Cattelan, werden auch sehr viele Anfragen, Verpflichtungen an ihn herangetragen. Zu sagen: «ich höre auf» war also auch ein Befreiungsschlag und Neubeginn. Am Montag beginnt die Kunstmesse Art Basel, und in der Fondation Beyeler ist auch allerlei los – sehnen Sie in solchen Wochen auch eine Befreiung von Stress herbei? Nein, denn es macht Freude, Ausstellungen vorzubereiten, und es ist sinnvoll, sein Museum im besten Licht zu präsentieren, wenn die internationale Kunstwelt nach Basel kommt. Ich freue mich! Als Verwaltungsrats- präsident der Art Basel – wie zufrieden sind Sie mit der Premiere der Messe in Hongkong? Ich bin begeistert! Es war ein grosser Erfolg, grösser als erwartet. Vergleichbar mit der Premiere in Miami? Ja, absolut. Obwohl mit Miami und Hongkong ist es für die Art Basel ein bisschen wie mit dem ersten und zweiten Kind. Beim ersten ist alles noch neu, beim zweiten weiss man schon etwas besser, was einen erwartet. Ich bin glücklich für die Eltern, Marc Spiegler und Annette Schönholzer, dass ihr Kind so einen guten Start hatte. Wie muss man sich eigentlich Ihre Funktion bei der Messe vorstellen? Geben Sie dem Leitungsteam auch Ratschläge? Nein, das brauchen meine Nachfolger nach so vielen Jahren nicht. Sie machen einen super Job. In dem Gremium, in dem ich bin, geht es mehr um strategische und konzeptuelle Fragen. Die Fondation Beyeler wächst durch Geschenke und Kooperationen, etwa mit der Stiftung Daros oder mit dem Galeristen Bruno Bischofberger. Ist das ein neuer, expansiver Kurs? Die Zusammenarbeit mit anderen Institutionen und Sammlungen war immer ein Anliegen von Ernst und Hildy Beyeler. Wir intensivieren diese, wobei wir jetzt auch die Möglichkeit haben, mit weltbesten Museen zu kooperieren: mit der Tate Modern in London, dem Stedelijk in Amsterdam, der Albertina in Wien oder dem Guggenheim in New York. Mit der Daros Collection ist es eine langfristige Partnerschaft, mit der Sammlung Bischofberger eine Premiere. Sie zeigen eine neue Sammlungspräsentation, haben mehrere neue Ausstellungen im Haus, präsentieren Skulpturen von Thomas Schütte in Zürich – und dann veranstalten Sie noch ein Konzert von Element of Crime? Auch das war ein Anliegen des Gründerpaars, dass die Vermittlung der Kunst an möglichst breite Schichten und neue Generationen im Zentrum aller Bemühungen steht. Hat Element of Crime überhaupt einen Bezug zu Kunst? Klar! Wir haben die Mitglieder dieser populären Rockband gerade von der Art Basel her gekannt. Sie sind mit Künstlern befreundet und leben mit Kunst, jeder auf seine Weise. Wir werden ihre private Sammlungen nun parallel zum Konzert im Sarasin Park in der dortigen Orangerie ausstellen. Werden Sie an der Messe Ankäufe machen? Ja, die Fondation wächst auch in dieser Hinsicht. Letztes Jahr haben wir an der Art Basel mehrere wichtige Werke erworben: beispielsweise Skulpturen von Lucio Fontana oder Louise Bourgeois. Wie gross ist Ihr Ankaufsetat? Den kommunizieren wir nicht. Aber selbst Millionen sind heute oft nicht genug, wenn man auf dem Qualitätsniveau, welches die Sammlung Beyeler vorgibt, kaufen möchte. © SonntagsZeitung; 09.06.2013; Seite 41 Inmitten des Basler Kunst- Tornados bietet die Fondation Beyeler Exquisites. Jetzt gehts los, und wenn
Sam Keller über «seinen» Cattelan Read More »