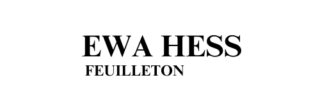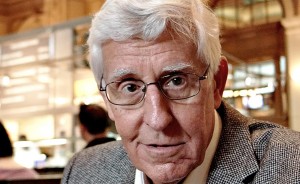Yoncé total
Yoncé total Ewa Hess | 22. Dezember 2013 – 12:19 Auf der Busfahrt von Zuoz nach Ascona hörte ich vor einigen Jahren Beyoncé mit gedrückter Repeattaste. Seither ist sie mir nah. Die überwältigenden neuen Videos wirken – nicht nur darum – stark auf mich. Doch dann kommen langsam die Zweifel. Yoncé, ist das nicht ein bisschen übertrieben? Da war selbst Madonna bescheidener… Sie ist die Sonnevon Ewa Hess Sie stakst auf ihren starken Beinen durch – ja, was ist das eigentlich? Eine unterirdische Garage? Eine postindustrielle Einöde? Zerfetzte Überreste eines grünen Korsetts verhüllen ihren wohlgewachsenen Körper höchst ungenügend. Auch das ausgefranste Top ist zu kurz: Die grossen, schweren Brüste schauen unten heraus. Gerade so viel, dass man irritiert hinsehen muss. Weil jederzeit mehr rausrutschen könnte. Was es wundersamerweise nicht tut. Kein Zweifel, diese Frau hat Superkräfte. Unter ihrer islamischen Kopfbedeckung leuchten die schwarz geschminkten Mandelaugen mit revolutionärer Glut. Wenn sie ihre Hand ausstreckt, züngelt das Feuer am Horizont. In ihrem Gefolge – allerlei finstere Gestalten, es sind Entrechtete und Beleidigte dieser Welt. Das ist sie, die neue Beyoncé. Die Königin von uns allen. Die Herrscherin über das politisch korrekte Pop-Universum. Sie ist eine Prophetin der Slums. Aber auch die einzige Gerechte unter den Reichen. Zudem eine Märtyrerin ihrer Schönheit. Dennoch eine Verkünderin der Freude in freudloser Welt. Sie ist die Sonne. Die Mutter der künftigen Generationen. Bah, in der Pietà-Pose des Videos «Mine» ist sie gar die Mutter Gottes. Beyoncés neues Album ist am Freitag, dem 13., wie ein Meteorit vom Himmel gefallen. Und wie ein Gestirn blendet es die Massen weitum mit Bildern, die sich auf der Netzhaut einbrennen. Sie strotzen nur so von starker Symbolik: Waterbording und Schönheits- Chirurgie, Kirmesplatz und Polizeiangriff, Sex in Limos und Kämpferinnensquads . . . Dazu ambitionierte Choreografien in luftigen Issey-Miyake-Roben als Pausenfüller. In diesen 17 (!) neuen Videos haben Beyoncé und ihr Gatte Jay-Z die ganze moralische Glaubwürdigkeit der Welt für sich gepachtet. Sie sind die Aufständischen des arabischen Frühlings, die leidenden Christen, die syrischen Demonstranten, die Gefolterten Guantánamos, die tapferen Wüstenkrieger und die furchtlosen Stadtguerillas. Dazu sind sie die Verfechter der wahren Schönheit in einer von Künstlichkeit geprägten Welt. Und sie lieben sich mit der einzig wahren Liebe zwischen Mann und Frau. Ihr Kind Blue Ivy, das Pfand ihrer überirdischen Verbindung, muss der neue Messias sein. Echt, Yoncé, Queen Bey, Sasha Fierce, oder wie deine vielen Namen heissen: Ist das nicht etwas übertrieben? Da war selbst Madonna bescheidener. Sie nannte sich nur nach der Mutter Gottes. Für eine gehalten hat sie sich nie. «Beyoncé» gibt es für 24 Fr. auf iTunes zu kaufen. Allein die 14 Songs und 17 Videos runterzuladen, dauert eine 3/4-Stunde About Ewa HessSwiss journalist, Editor Arts @Sonntagszeitung, ZürichView all posts by Ewa Hess » @askewa @PSPresseschau Wunderbares textlein 🍀 thx 4 sharing 08:10:37 PM Mai 30, 2023 von &s in Antwort auf PSPresseschau@GESDA Hackathon 4 the future – Open Quantum Institute in the making. Impressive! https://t.co/hWBdlsEFkd 09:35:19 AM Mai 07, 2023 von &s in Antwort auf GesdaIt’s my #Twitterversary! I have been on Twitter for 13 years, since 26 Nov 2009 (via @twi_age). 01:00:51 AM Dezember 13, 2022 von &s @askewa folgen Neueste Beiträge Baselitz‘ WeltI likePrivate Sales, ein SchattenspielAdieu John BergerTalk mit Jacqueline Burckhardt Blogroll FAQNews-BlogPop MattersRevue 21Support ForumWordPress-Planet Themen Ai Weiwei Amerika Andy Warhol Aphrodite Ascona Baron Heinrich Thyssen Basel Biennale Venedig Bird’s Nest Caravaggio China Fischli/Weiss Fondation Beyeler Frank Gehry Georg Baselitz Gerhard Richter Ghirlandaio Gstaad Gurlitt Gustav Klimt Harald Szeemann Keanu Reeves Kunst Kunstmuseum Basel Louise Bourgeois Maja Hoffmann Maria Lassnig Marlene Dumas Melinda Nadj Abonji Monte Verità Nachtkritik Oprah Winfrey Pipilotti Rist Schweizer Architektur Schweizer Film Schweizer Kunst Schweizer Literatur Shakespeare Simon de Pury Thomas Hirschhorn Ugo Rondinone Urs Fischer Valentin Carron Warhol Weltwoche Next Post Schreibe einen Kommentar Cancel Reply Logged in as Ewa Hess. Edit your profile. Log out? Required fields are marked * Message*