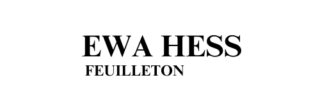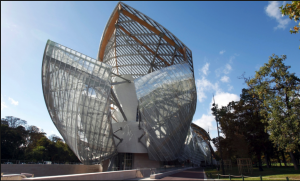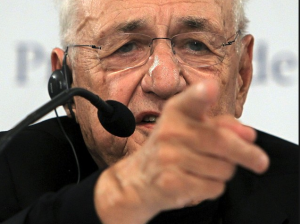Pamela Rosenkranz
Pamela Rosenkranz Ewa Hess | 28. April 2015 – 11:05 Nein, aus dem Schweizer Pavillon blubbert nichts heraus. Ein verstohlener Blick auf das noch nicht fürs Publikum zugängliche Gelände der Biennale bestätigt es. Der Backsteinbau im Eingangsbereich der Giardini sieht aus wie immer: unauffällig. Keine Spur von den geheimen Mixturen, die Pamela Rosenkranz, unsere Frau in Venedig, darin anrichtet. Aus dem Schatten der Bäume in der Parkallee, in der eine emsige Geschäftigkeit herrscht, löst sich eine schmale Frauengestalt, und Pamela Rosenkranz kommt uns entgegen. Es ist Mittagszeit in Venedig, es riecht nach Pasta mit Sugo. Die Künstlerin zieht ihre dunkelblaue Jacke enger um die Schultern, sie scheint an diesem warmen Apriltag zu frösteln. Die Konzentration auf die Arbeit umgibt sie wie eine kalte Seifenblase. Kaum sind unsere Primi und Secondi in einer kleinen Trattoria bestellt, kommt das Gespräch aufs Produkt. «Unser Produkt». Die hautfarbene Masse. «Our Product», so heisst Pamela Rosenkranzs Arbeit in Venedig. Gerade sie, die in der Gemeinde der jungen Post-Internet Künstler als spröde Wissenschaftlerin auffällt, wird den nüchternen Schweizer Pavillon mit einer sinnlich wogenden Installation konfrontieren. Dabei hat es der Schweizer Pavillon in Venedig den Künstlern nie leicht gemacht. Das Bauwerk von Albertos jüngstem Bruder Bruno Giacometti aus den 1950er-Jahren ist zwar die Ruhe selbst: drei Räume und ein Innenhof, mit gekonnt gebrochenem Tageslicht ausgestattet. Der Bau appelliert an das Gefühl der Bescheidenheit, wohl darum greifen ihn selbst provokante Künstler nur selten frontal an. Thomas Hirschhorn hat hier vor vier Jahren eine hochkomische Tropfsteinhöhle aus Wattestäbchen und Alufolie eingerichtet. Valentin Carron, der Star aus der Romandie, fügte sich vor zwei Jahren der Schönheit der Räume mit einem ruhigen Ensemble. Die perfekte Metapher: Der Mensch als Ursuppe Mit ihrem unheimlichen Labor voll hautfarbener Unappetitlichkeiten macht nun die junge Künstlerin so etwas wie eine Hexenküche auf im ehrwürdigen Schweizer Häuschen. Am Anfang ihrer Arbeit in Venedig stand allerdings ein Gedicht: «Monalin – Moriosyl – Morium», murmelt sie jetzt einige Wörter daraus, während wir auf den Fisch warten, «Mylium – Mymone – Nanindor». Sind das unbekannte Botenstoffe? So etwas wie Serotonin, Noradrenalin, Insulin? Naive Frage meinerseits, die mit einem Anflug von Lächeln belohnt wird. Natürlich nicht. «Das ist das lexikalische Feld der Arbeit», sagt sie. Hunderte dieser Wörter hat sie ersonnen, um das Produkt zu definieren. Sie hat den Hautton des durchschnittlichen Europäers errechnet, Pigmente angerührt, die Formulierung für eine zähe Flüssigkeit daraus abgeleitet, die sie noch mit echten Ingredienzen anreichern will. Bald wird sie all das vor Ort zu einem Exponat mischen, dessen wellenartig bewegte Masse den ganzen Raum füllt. Maschinell mahlender Sound und eigens entworfene Gerüche machen die Metapher perfekt: der Mensch als Ursuppe. «Vielleicht Ursuppe» sagt Rosenkranz. «Oder aber nicht Suppe, sondern das Wasser von San Lorenzo», sagt sie und hebt den Blick. Sie hat sich nun warmgeredet. Pamela Rosenkranz erzählt mir von ihrer venezianischen Inspiration. «Miracolo della croce caduta nel canale di San Lorenzo» heisst das Bild. Das in der Accademia ausgestellte Gemälde zeigt eine Szene aus dem mittelalterlichen Venedig. Das Kreuz, eine heilige Reliquie mit einem Splitter des echten Kreuzes Jesu, ist ins Wasser gefallen. Die umstehenden Menschen – es ist eine ansehnliche Menge – sind vor Schrecken erstarrt. Einige versuchen es zu retten. Ein venezianischer «Mohr» hat sich schon ausgezogen, um ins Wasser zu springen. Doch der Ordensvorsteher Andrea Vendramin (er hat das Bild beim Maler Gentile Bellini bestellt) ist schneller, er hält das Allerheiligste bereits sicher in der Hand und trägt es ans Land. «Ähnlich wundersame Wirkung wie damals von den Reliquien, erhofft man sich heute von Lebensmitteln oder Medikamenten», sagt die Schöpferin der modernen Ursuppe. Wir denken beide, schweigend, an ein bestimmtes Süssgetränk, das Flügel verleihen soll. Früh stürzte sie sich in die Geheimnisse der Life-Sciences Als eine platte Kritik an kapitalistischer Lebensvermarktung will Rosenkranz ihre Kunst dennoch nicht verstanden wissen. «Eine platte schon gar nicht», sagt sie schnippisch und zeigt wieder ein kleines Lächeln. Auswüchse des kapitalistischen Übergriffs auf die menschliche Integrität machen ihr trotzdem, wie jedem, Sorgen. «Wenn man anfängt, Brustkrebsgene zu patentieren, könnte es in einer nächsten Phase geschehen, dass ökonomische Interessen die Ärzte an der Lebensrettung hindern», sagt sie. Dagegen aufzurütteln sieht sie aber nicht als die Aufgabe ihrer Kunst an. Das stimmt zwar, sie stellt das Menschliche auf eine inhumane Art dar («Inhuman» hiess etwa die Ausstellung im Fridericianum in Kassel, bei der sie bereits mit der Kuratorin Susanne Pfeffer zusammengearbeitet hat, die auch den Schweizer Pavillon kuratiert) – aber sind wir Menschen nicht wirklich auch als die Summe von Farben, Ingredienzen und Einflüssen zu verstehen? Die blitzgescheite Tochter eines Juristen und einer Physiotherapeutin aus Spiez stürzte sich früh in die Geheimnisse der zeitgleich mit ihr aufblühenden Life-Sciences: Neurowissenschaft, Biochemie, Genetik. Auch heute verschlingt Pamela Rosenkranz wissenschaftliche Essays wie andere Romane. Sie ist mit Wissenschaftsphilosophen wie Reza Negarestani befreundet, auch ihr Mann ist einer. Sie ist ein ernstes Geschöpf, diese 35-jährige Absolventin der Berner Kunstschule mit dem Namen einer Bühnenheldin (wir erinnern uns an Hamlets Schulfreunde Rosencrantz und Guildenstern). Es ist ihr echter Name, der ihres Vaters, den sie in einem Anflug von neckischer Zärtlichkeit als den «Woody Allen des Berner Oberlandes» bezeichnet. Momente, in denen sie etwas von ihrem Innenleben zeigt, sind sonst selten. In ihrer logischen und rationellen Art ähnelt Pamela Rosenkranz meist ein bisschen der schönen Replikantin aus Ridley Scotts Kultfilm «Blade Runner» – man meint während des Gesprächs, die Rechenleistung des Computers hinter der Stirn leicht surren zu hören. «Rational bin ich eigentlich nicht», sagt sie jetzt, wie stets um höchste linguistische Präzision bemüht, «cerebral triffts besser.» Wenn so viele sie gut finden, ist sie wohl auch gut Diese Wesensart muss als Erklärung dafür herhalten, dass gerade jetzt, im Vorfeld der Biennale, Medienstimmen laut werden, die Pamela Rosenkranz eine berechnende «Blitzkarriere» hämisch zur Last legen. Sie sei eine «strategische Netzwerkerin» (schreibt «Die Zeit»), «Karriere nach Masterplan» bescheinigt ihr die «Schweiz am Sonntag». Tatsächlich hat die wegweisende Arbeit der jungen Frau schon früh Eingang in zeitkritische Gruppenschauen gefunden: Berlin Biennale, Manifesta, Kunsthallen in der Schweiz und weltweit, Swiss Insititute New York …