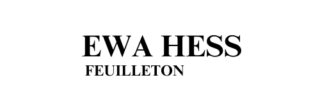Büchels Moschee in Venedig
Büchels Moschee in Venedig Ewa Hess | 27. Mai 2015 – 10:57 Ich war an der Eröffnung von Christoph Büchels Kunstprojekt in Venedig dabei. Der Island-Schweizer liess an der Biennale die Muslime in einer umgenutzten katholischen Kirche beten. Bis die Stadt das Gebäude schloss. Nach den starken, intensiv positiven Emotionen der Eröffnung, die zu einer wunderbaren Versöhnungsfeier der Religionen wurde – unverständlich und dumm. Also doch. Am Freitag schlossen die venezianischen Stadtbehörden die Installation «The Mosque» des Schweizer Künstlers Christoph Büchel. Nach zwei Wochen der Diskussionen, der Anzeigen und der darauf folgenden staatlichen Kontrollen teilte die Stadtverwaltung von Venedig den Verantwortlichen des isländischen Pavillons und der Biennale mit, dass die Genehmigungen zurückgenommen worden seien. Die Gebetswilligen erhielten keinen Einlass mehr. Der Fall ist interessant. Es geht um den Umgang mit Religion und um unsere Bereitschaft, die liberalen Tendenzen des Islam zu stärken. Eine politische Kunst hatte der Biennale-Leiter Okwui Enwezor gefordert. Und «The Mosque» löste diese Forderung besser ein als die beiden Hauptausstellungen der Biennale. Die Projekte des in Island lebenden Schweizers zielen immer in die Mitte einer schwelenden sozialen Unruhe. In Venedig, der traditionellen Pforte zum Orient, sind die islamischen Kultureinflüsse überall anzutreffen. Trotzdem gab es im historischen Zentrum der Stadt nie eine funktionierende Moschee. Ein Lager wird zur Moschee Diese zu finden, war eine Aufgabe nach Büchels Gusto. Nur – und das ist der provokative Teil seines Beitrags –, er richtete diese Kunst-Moschee in einer katholischen Kirche ein, in der Santa Maria della Misericordia de L’Abazia, die er nach langer Suche fand. Die Kirche wurde Anfang der 70er-Jahre privatisiert und desakralisiert (die Gegner behaupten zwar, der Akt der Desakralisierung habe nicht stattgefunden, doch die Isländer haben Belege). Die ehemalige Kirche wurde bisher als Lagerraum gebraucht und kann gemietet werden. Büchel stattete die Kirche als Moschee aus, mit Teppich samt aufgemalten Gebetsnischen, orientalischem Lüster, Koransprüchen über den Türen, einer Mihrab-Nische, welche die Gebetsrichtung anzeigt, und einem LED-Display mit aktuellen Gebetsstunden. Die Eröffnung am 8. Mai geriet zu einer herzerwärmenden Feier der Verbrüderung. Mohammed Amin al-Ahdab, ein Architekt und Präsident der islamischen Gemeinde Venedigs, dankte in einer Rede für die «Magie der Kunst», welche die «Herzen der Muslime» erleuchte. Manche Männer beteten vom ersten Moment an. Frauen fühlten sich auf ihrer Empore wohl, Kinder kreischten. Das Kunstvolk zog folgsam die Schuhe aus. Trotzdem: Die Proteste begannen sofort nach der Eröffnung und kulminierten in einer Anzeige, die der venezianische Kunsthistoriker Alessandro Tamborini erstattete. Er weigerte sich, beim Besuch seine Schuhe auszuziehen: Da dies ein Pavillon der Biennale sei, könne es sich nicht um einen Kultort handeln. Also schloss die Stadtverwaltung um der Ruhe willen jetzt die «Mosque». Unter dem formalistischen Vorwand, dass die Maximalzahl von Besuchern überschritten wurde. Das befriedigt nun aber weder die Gegner, die ein Exempel statuieren wollten, noch die Organisatoren, die auf eine offene Diskussion über den Umgang mit den Grundrechten der islamischen Minderheit in Italien hofften. Denn nach der Schliessung regt sich auch in Kunstkreisen Kritik. Kritik an Büchel Büchel spiele mit dem Feuer, heisst es, er provoziere eine mediale Schlammschlacht, die auch islamische Fanatiker alarmieren könnte. Indem er darauf bestehe, seine Aktion in einer Kirche zu inszenieren, riskiere er verletzende Bemerkungen und befeuere eine Hetze gegen just die Menschen, bei deren Integration er helfen wollte. Dass «The Mosque» dennoch ein Projekt ist, das die liberalen Tendenzen des Islams stärkt, zeigte sich deutlich an der Eröffnungsfeier. Es ist doch immerhin erstaunlich, dass die islamische Gemeinde Venedigs sich dem Biennale-«Tross» vorbehaltlos geöffnet und die zwar wohlmeinenden, aber schrillen Kunstliebhaber aus aller Welt in ihrer Mitte mit offenen Armen empfangen hat. Wem übrigens die Vermischung von Kunst und Religion nicht ganz geheuer vorkommt, kann einen Abstecher in eine der vielen anderen Kirchen der Stadt machen. Dort werden die grössten Werke der abendländischen Kunst von Touristenmassen bestaunt, während venezianische Omas inbrünstig beten. Publiziert im Tages Anzeiger am 27. Mai 2015 About Ewa HessSwiss journalist, Editor Arts @Sonntagszeitung, ZürichView all posts by Ewa Hess » @askewa @PSPresseschau Wunderbares textlein 🍀 thx 4 sharing 08:10:37 PM Mai 30, 2023 von &s in Antwort auf PSPresseschau@GESDA Hackathon 4 the future – Open Quantum Institute in the making. Impressive! https://t.co/hWBdlsEFkd 09:35:19 AM Mai 07, 2023 von &s in Antwort auf GesdaIt’s my #Twitterversary! I have been on Twitter for 13 years, since 26 Nov 2009 (via @twi_age). 01:00:51 AM Dezember 13, 2022 von &s @askewa folgen Neueste Beiträge Baselitz‘ WeltI likePrivate Sales, ein SchattenspielAdieu John BergerTalk mit Jacqueline Burckhardt Blogroll FAQNews-BlogPop MattersRevue 21Support ForumWordPress-Planet Themen Ai Weiwei Amerika Andy Warhol Aphrodite Ascona Baron Heinrich Thyssen Basel Biennale Venedig Bird’s Nest Caravaggio China Fischli/Weiss Fondation Beyeler Frank Gehry Georg Baselitz Gerhard Richter Ghirlandaio Gstaad Gurlitt Gustav Klimt Harald Szeemann Keanu Reeves Kunst Kunstmuseum Basel Louise Bourgeois Maja Hoffmann Maria Lassnig Marlene Dumas Melinda Nadj Abonji Monte Verità Nachtkritik Oprah Winfrey Pipilotti Rist Schweizer Architektur Schweizer Film Schweizer Kunst Schweizer Literatur Shakespeare Simon de Pury Thomas Hirschhorn Ugo Rondinone Urs Fischer Valentin Carron Warhol Weltwoche Previous PostNext Post Schreibe einen Kommentar Cancel Reply Logged in as Ewa Hess. Edit your profile. Log out? Required fields are marked * Message*
Büchels Moschee in Venedig Read More »