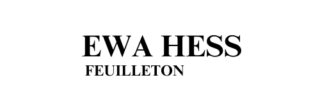Neue Kunstrituale in Rio
Neue Kunstrituale in Rio Ewa Hess | 4. Februar 2013 – 07:44 In Rio de Janeiro erwacht eine neue Kunstszene – anlässlich einer Reise im Zusammenhang mit der bevorstehenden Eröffnung der Casa Daros im Quartier Botafogo habe ich mich mal unter dem Zuckerhut umgesehen. Foto: Fred Merz/Rezo Rio ist eine Schleuder. Das behauptet der Künstler José Bechara. Und er muss es wissen, denn er schaut täglich von oben auf seine Heimatstadt. Auf der Terrasse seines Ateliers im Villenviertel Santa Teresa breitet er Leinwände vor uns aus. Eine tropisch verschleierte Sonne legt sich derweil zu Füssen des Zuckerhuts schlafen. «Die lateinamerikanische Kunst», sagt José und unterstreicht die Aussage mit einer dezidierten Bewegung seiner kubanischen Zigarre, «wird von Rio aus die Welt erobern.» Denn nur von hier aus fliegen Ideen mit Zentrifugalkraft in die Welt – wie einst der entspannte Rhythmus des Bossa nova. Darum sei es klug von den Schweizern, mit ihrer Casa Daros nach Rio zu kommen. Bechara selbst ist ein cooler Typ mit Dächlikappe und rauer Stimme. Jeder seiner Sätze klingt wie ein Sprichwort. «Geld kommt nach Rio wegen seiner Ölfelder», sagt er etwa, «Künstler aber kommen nach Rio, weil diese Stadt bereit ist, sich zu verschwenden.» Obwohl keines seiner eigenen Werke von Daros Latinamerica angekauft wurde, ist er auf die Sammlung gut zu sprechen. Er ist überzeugt, dass es ein Fehler der Kunstszene war, die Gründung eines Ablegers des Guggenheim-Musems in Rio, damals 2003, durch Proteste zu verhindern. «Abwehr», sagt er, «ist eine so altmodische Idee.» «Ist der Umbau der Casa Daros endlich fertig?», will Bechara jetzt wissen. Ein Schaufenster für Kunst verschiedener lateinamerikanischer Länder in Rio einzurichten, hält er für eine grossartige Idee. Fügt aber nach einigem Nachdenken hinzu: «Falls es funktioniert.» Der Nachsatz ist berechtigt. Die Kunstszene Rios ist bisher eine recht überschaubare Gemeinschaft. Sie organisiert sich rund um das Museu de Arte Moderna (MAM Rio), einer von Brasiliens grossartig kühlen, modernistischen Betonbauten im Quartier Flamengo unten am Meer. Mit seinen 200 000 Eintritten pro Jahr erlaubt das Beispiel des Museums keine brillante Prognose für die hochfliegenden Daros-Pläne, die mit dem Potenzial einer kunsthungrigen Sechs-Millionen-Metropole rechnen. Dass aber Kunst, Geld und Macht in Rio gerade anfangen, Gefallen aneinander zu finden, das lässt sich beim Besuch im Haus auf Betonpfeilern nicht übersehen. Der Enkel des Medienmoguls buhlt um Museumssponsoren Der Aufsichtsrat-Präsident des Museums, Carlos Alberto Gouvea Chateaubriand, empfängt seine Besucher im Restaurant im ersten Stock. Sein Grossvater, Francisco de Assis Chateaubriand, war einer der einflussreichsten Männer des Landes, ein gefürchteter Medienmogul der Nachkriegsjahre, der als «brasilianischer Citizen Kane» in die Geschichte einging. Im neuen, um eine vorzeigbare politische Korrektheit bemühten Brasilien von heute steht sein Name für alles, das es zwar noch gibt, aber nicht mehr geben sollte: Erpressung, Korruption, Bereicherung durch Macht. Den Namen von Napoleons Botschafter Chateaubriand hat der damalige Emporkömmling aus Nordostbrasilien als Jüngling für sich usurpiert – er ist in der Familie geblieben. Das nach dem gleichen Mann benannte Stück Fleisch wird im Museumsrestaurant Laguiole nicht serviert, dafür ein hauchzarter Blanc manger aux truffes. Wenn man die Vorspeise lobt, ruft der Präsident mit einem Fingerschnippen den Koch, der im perfekten Französisch das Rezept verrät. Alles hier ist darauf ausgerichtet, die Reichen und die Einflussreichen zu verwöhnen. Denn sie sollen zahlen – Staatssubventionen für Museen stehen im Boomland Brasilien nicht zuvorderst auf der politischen Agenda. Weder das MAM Rio noch das auf der anderen Seite der Guanabara-Bucht gelegene, von Brasília-Planer Oscar Niemeyer erbaute Museu de Arte Contamporânea de Niteroi, erhalten Budget-Zuwendungen. Für jede Ausgabe muss ein Sponsor her. Der zerschlissene Spannteppich im Innern des in jedem Touristenführer als Weltwunder gepriesenen Niemeyer-Baus in Niteroi erzählt von diesen Zuständen. Da hat es das MAM Rio besser. «Ich weiss, wie man mit diesen Leuten spricht, damit sie uns Geld geben», sagt der Enkel des Medienzaren und prostet dem Telenovela-Produzent Luiz Barreto zu, der gerade hereinkommt. Grossvater Chateaubriand pflegte die Industriemagnaten seiner Zeit zu erpressen, um Modiglianis, Tizians und Picassos fürs Museum in Sa?o Paulo zu kaufen. Heute undenkbar – und doch wecken diese ältere Herren in hellen Anzügen, die im Museumsrestaurant ein- und ausgehen, einschlägige Mafiafilm-Klischees. «Wie geht es der Tochter, Mario?», «Setzt dich zu uns, Paulo»: – damit sind der mächtige Chairman des Energieunternehmens Enel Endesa, Mario Santos, oder der CEO des Elektrizitätsgiganten Light, Paulo Roberto Pinto, gemeint. Einander in ihrer weichen Sprache Witzchen und Koseworte zurufend, kontrastieren diese Patriarchen mit den kargen Räumen des Museums, wo einst, in den 60er- und 70er-Jahren, zur Zeit der Militärdiktatur, Oppositionelle zusammenkamen «um zu besprechen, was getan werden musste und wer gerade verhaftet worden ist» – wie uns der Künstler Antonio Dias erzählt. Dias ist der Doyen der Kunstszene in Rio. Vor der Verfolgung des Militärregimes flüchtete er nach Europa, lebte lange in Mailand. Er ist jetzt 69 Jahre alt und krank. Er hat sich ein Auge verletzt, bei der Behandlung wurde Krebs diagnostiziert. Vor zwei Jahren kam er zurück, nach Hause, um hier wieder heil zu werden. Er ist der Meister Yoda von Rios Kunstszene, ein Weiser, der in Rätseln spricht. Die um Jahrzehnte jüngere italienische Frau Paola und Tochter Nina gehen im Haus umher, schwatzend, rauchend, Getränke schlürfend. Die Kunstvermittlungskurse in der Favela laufen schon Dias ist ein typischer Daros-Künstler. In der von Ruth Schmidheiny und Hans-Michael Herzog angelegten Sammlung lateinamerikanischer Kunst ist diese Generation bisher am stärksten vertreten. Die ganz jungen Künstler sind den bedächtigen Einkäufern oft noch nicht «reif» genug, haben die Probe der Zeit noch nicht bestanden. Die Werke älterer Künstler, etwa der beiden Säulenheiligen der brasilianischen Moderne, Helio Oiticica oder Lygia Clark, waren im Jahr 2000, als Daros Latinamerica anfing, bereits sehr teuer. «Dennoch», erklärt Hans-Michael Herzog, «konnten wir uns einige wichtige Positionen dieser Künstler sichern.» Auf die Frage nach der Bedeutung der kommenden Eröffnung der Casa Daros für Rio antwortet Antonio Dias gewohnt vage – ja, das Kulturhaus sei wichtig. Er würde sich wünschen, dass dort eine Kunstzeitschrift initiiert werde. Er vermisse ein Forum. «Die Daros-Leute setzen schon jetzt Standards», gleicht Paola freundlich die nicht gerade überbordende Begeisterung ihres wortkargen Mannes
Neue Kunstrituale in Rio Read More »