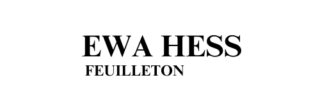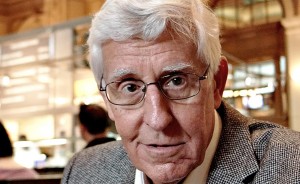Bärfuss vs. Berset
Bärfuss vs. Berset Ewa Hess | 17. Mai 2015 – 10:26 Nachdem die Solthurner Literaturtage eine Begegnung zwischen dem Schriftsteller Lukas Bärfuss und dem Bundesrat Berset angekündigt haben, bat ich Bärfuss um ein Treffen – im Vorfeld. Wir unterhielten uns dann im Bahnhofbuffet Zürich über die Sprache der Politik, die Macht des Virtuellen und Max Frisch als StrafaufgabeEwa Hess Ihre Diskussion mit Bundesrat Berset wird in der Presse als «Bärfuss gegen Berset» angekündigt. Ein Kräftemessen? Nein, ein Kampf ist nicht beabsichtigt. Ich kenne nur einen Gegner – das sage ich auf die Gefahr hin, eitel zu klingen –, das bin ich selbst. Deshalb fange ich mit der Kritik immer bei mir an. «Zur Sprache finden» heisst das Thema – diskutieren Sie auf Deutsch oder auf Französisch? Damit sind wir schon mitten in der Diskussion um die Schweizer Identität, in der es immer auch um die Vielsprachigkeit geht. Das wird interessant werden. Interessant oder intéressant? Ich versichere Ihnen, mein Französisch ist gut genug. Sie werden sich also auf Französisch unterhalten? Sicher auch. Sprechen Politiker und Schriftsteller vom Gleichen, wenn sie von der Sprache sprechen? Jedenfalls bewegen sich Politiker – wie die Schriftsteller auch – in einem System, das sprachlich definiert ist. Die Gesetze sind in Sätze gefasst. Die Bundesverfassung ist ein Text. In der Politik geht es aber um eine «Sprachregelung» – so nennt man die unverfänglichen Amtsformulierungen –, in der Dichtung hingegen um einen freien Umgang mit dem Wort. Dennoch ist ein Gesetz zuerst Sprache und muss also interpretiert werden. Deshalb geht den Anwälten die Arbeit nie aus. Mich als Schriftsteller interessiert aber vor allem das, was die Sprache nicht ausdrücken kann. Wie meinen Sie das? Der Schriftsteller ist einer, der die Sprache nicht versteht. Er bleibt ihr gegenüber kritisch, sucht ihre Grenzen. Erst dort gibt es etwas zu entdecken. Und der Politiker? Ein Politiker muss Interessen definieren und durchsetzen. Bei ihm heisst es: Wir bezahlen exakt so und so viel Steuern, die Höchstgeschwindigkeit ist siebzig, Frauen haben keine Quote und Ausländer weniger Rechte. Er setzt damit eine Wirklichkeit, und es gibt Menschen, die unter dieser Wirklichkeit leiden. Gerade darum verstecken sich doch Politiker gerne hinter sogenannten Unwörtern wie «Ventilklausel» oder «Klimakompensation». Politiker sind tatsächlich oft die Lieferanten dieser Worthülsen, doch nicht sie alleine schleusen sie in den öffentlichen Diskurs ein. Sehen Sie die Rolle des Schriftstellers darin, die Öffentlichkeit dafür zu sensibilisieren? Die Verantwortung für eine adäquate Sprache soll man weder an Schriftsteller noch an Politiker delegieren. Die Aufgabe haben alle. In Ihrem Buch «Stil und Moral» sprechen Sie von einer «wachen» im Gegensatz zu einer «schlafenden Öffentlichkeit». In diesem Essay, «Das Volk und ich», geht es um die Rechtfertigung der Volksinitiative als ein Instrument der Veränderung. Aber ohne Zweifel verändert sich die Öffentlichkeit gerade dramatisch. Woran erkennen Sie das? Es gibt so etwas wie eine gesellschaftliche Hypnose. Wir sind alle endlos fasziniert von unseren technologischen Möglichkeiten. Das Virtuelle definiert die Orte, Methoden und Prozesse des Öffentlichen um, während aber unser Staat und viele unserer Rechte noch eine physische Präsenz voraussetzen. Seit dem Erscheinen von «Stil und Moral» werden Sie als das Gewissen der Schweiz gefeiert, als neuer Max Frisch. Ist das ein Kompliment für Sie? Ich weiss, dass es als Kompliment gemeint ist, und darum freut es mich. Es hilft mir aber nicht bei der Arbeit. Zuschreibungen sind keine Denkhilfe. Wie stehen Sie zu Max Frisch? Ich habe zu Frisch eine lange Beziehung, die früh in meiner Schulzeit begann. Wie jeder Schweizer – seine Werke sind Schullektüre. Ich bekam seine Texte als Strafaufgabe. Wie das? Ganz konkret, ich musste sie zur Strafe aus dem Lesebuch abschreiben. Die Höchststrafe war «Der selbstsüchtige Riese» von Oscar Wilde, das waren neun Seiten. Bei geringeren Vergehen gabs «Der andorranische Jude» von Frisch. Der war kürzer. Frisch war für mich also das kleinere von zwei Übeln. Sehen Sie sich selbst als seinen Nachfolger? Nein, der Vergleich ist unzulässig. Max Frisch und ich sind nicht Zeitgenossen. Er sah sich einer anderen geschichtlichen Situation gegenüber. Das bipolare politische System existierte damals noch. Und auch die atomare Bedrohung. Während jetzt … … ja, wie ist die Situation jetzt? Deutlich unübersichtlicher. Es fällt zudem schwer, die eigene Situation zu analysieren. Es bleibt ein Ringen, während man versucht, eine Haltung zu entwickeln … Wie Sie es kürzlich in der Sendung «Arena» zur Flüchtlingstragödie taten? Da reagierte ich auf eine konkrete Situation: Die Anfrage für die Sendung kam während meiner Ferien. Und? Ich war mit meiner Familie am Mittelmeer. Das Wasser war schrecklich kalt. Dazu die Bilder der Katastrophe vor der Küste Libyens in den Medien. Ich konnte dem Thema nicht ausweichen und beschloss, mich der öffentlichen Diskussion zu stellen. Sie sagten in der Sendung, diese Flüchtlinge seien Helden. Warum? Weil sie für die Aussicht auf eine bessere Zukunft ihr Leben riskieren. Auch in dieser Diskussion spielt die Sprache eine wichtige Rolle. Nehmen wir ein Wort wie «Schlepper». Warum sagen wir nicht «Fluchthelfer»? Ich habe kürzlich mit einem Freund gesprochen, dessen Mutter nach dem Zweiten Weltkrieg aus den sowjetisch besetzten Zonen in den Westen geflohen ist – erfolgreich dank einem Fluchthelfer, dem man noch heute dankbar ist. Die Bezeichnung «Schlepper» beinhaltet eine Delegitimierung der Flüchtlinge, indem sie ihnen die Autonomie des Fluchtwunsches abspricht. Sie wurden im Verlauf der Sendung zunehmend stiller. Hat Sie die Diskussion enttäuscht? Nun, ich lege nur Wert auf Umgangsformen, möchte höflich bleiben und Menschen ausreden lassen. Das sind keine Tugenden, mit denen man in einer solchen Sendung zu Potte kommt. Das klingt wie eine – höfliche – Kritik an der «Arena». Nein, das sind die Spielregeln. Ich lebe gerne nach dem Prinzip, mich einmal pro Tag lächerlich zu machen. Im Unangreifbaren zu bleiben, würde mich langweilen. Rufen Sie darum Ihre Leser dazu auf, Ihr Buch wegzuwerfen? «Die Lektüre literarischer Essays ist moralisch nicht zu rechtfertigen», heisst es im letzten Satz von «Stil und Moral». Ich werde auf diesen Text oft angesprochen und merke, dass er nicht überall verstanden wird. Das ist eine poetische Haltung! Eine Polemik gegen eine Überzeugung der bürgerlichen Verfasstheit: dass uns
Bärfuss vs. Berset Read More »