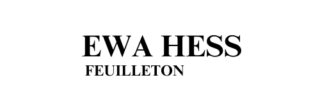X Freunde in Bern
X Freunde in Bern Ewa Hess | 21. November 2013 – 09:10 Ein Stück à la mode, das bitterböse Porträt der Generation Burnout, von der deutschen Autorin Felicia Zeller in atemlose Sätze gefasst. Über die Schweizer Erstaufführung in Bern schrieb ich für Nachtkritik.de. Bern, 20. November 2013. Es gibt sie auch in Bern, auch wenn sie in der gern als allzu gemächlich verspotteten Schweizer Hauptstadt eigentlich als der Inbegriff des Zürchers gelten: Die Email-Checker, Combox-Lauscher, Laptop-Streichler. Menschen wie Anne, wie Peter, wie Holger – kreative Selbstausbeuter, die sich auf der Jagd nach einem ungenügend definierten ökonomisch-narzisstischen Ideal unablässig den eigenen Rücken peitschen. Früher haben die drei als „Cappuccino-Trio“ Kaffeehäuser unsicher gemacht. Der süße Milchschaum dieser Tage ist aber längst passé. Die Erinnerung daran wird im Mund der fast Erfolgreichen zu einer fast verständlichen Floskel. Atemloser Singsang der Generation Burnout„Ich weiß manchmal gar nicht mehr, wo oder was, allein der Gedanke, wie viel ich noch zu tun habe, ich sollte eigentlich gar nicht hier sein“ – mit Sätzen wie diesen gelingt der Autorin Felicia Zeller nicht nur die Charakterisierung ihrer drei Helden im Stück „X-Freunde“. Mit diesen prädikatslos hinkenden Satzkrüppeln äfft sie den atemlosen Singsang der ganzen Generation Burnout nach. Einer Generation, der die physische und psychische Erschöpfung der Kräfte nicht nur zur Gefahr, sondern auch zur Ehre, zur Sehnsucht gar wird. Anne hat gerade ihre Stelle in einer Werbeagentur gekündigt. Deren Weltverbesserungsstrategie war ihr zu langsam, der seelenlose Abteilungsleiter stand ihr vor dem Selbstverwirklichungs-Glück. Nun gründet sie mit einem Kollegen eine eigene Firma, die wird „Wege aus der Gleichgültigkeitskrise“ mit einer Entschiedenheit verfolgen, die dem großen Thema gerecht wird. Derweil laboriert Freund Peter, ein Bildhauer mit Renommee in der Kunstwelt, an einem letzten Meisterwerk seiner Skulpturenreihe X-Freunde. Der letzte Freund soll der Schar der bisherigen erst so richtig einen Sinn verleihen. Nur blöd, dass die antizipierte Bedeutsamkeit des Werks die Inspiration wegscheucht. Weltrettungsrhetoriktriefende TiradenHolger, der Koch, wäre wohl der vernünftigste der drei. Wenn ihm nur nicht dieses fatale Malheur passiert wäre. Die von seiner Cateringfirma servierten Kaltwasserkrevetten waren verstrahlt. Nur leicht. Doch zwei Tote sind für einen Foodlieferanten keine gute Referenz. Holger versucht seither seinem arbeitslosen Leben an der Seite der hyperaktiven Anne einen Anstrich von Wichtigkeit zu geben. Ob Agenda-Einträge wie „Gartenhacke kaufen“ dabei helfen? Nicht sicher. In der Berner Inszenierung, in der Jan Stephan Schmieding für die erkrankte Regisseurin Franziska Marie Gramss eingesprungen ist, treten die drei Selbstdarsteller in greller Zirkusmanier auf einer rosaroten Stufenbühne von Barbara Pfyffer wie Conférenciers in Smokings auf. Das passt gut zu diesem aus lauter Monologen bestehendem Sprechakrobatik-Text. Milva Starks Anne schleudert mit animalischer Wucht ihre abwechslungsweise hass- und weltrettungsrhetoriktriefenden Tiraden ins Publikum. Die Furie ihres Auftritts konterkariert der intellektuell scheinbar abgeklärte, augenzwinkernd zynische Vortrag Peters. Jürg Wisbach gibt den Bildhauer weltmännisch, selbst in Momenten kreativer Verzweiflung meint man zu spüren, wie sich der auf den Zuspruch der Kuratoren und des Publikums bedachte Schöpfer selbst beobachtet. Die wärmste Note des Abends schlägt Stefano Wenk als Annes Mann Holger an. Seine starke physische Präsenz bringt die verbalen Seifenblasen des Dialogs immer wieder zum Platzen.Zeitgeist beim Schopf gepacktUnd doch fragt man sich im Verlauf des anderthalbstündigen Abends immer öfter, ob es eine kluge Entscheidung war, den vom Fachmagazin Theater heute mit dem Titel „Stück des Jahres 2013″ ausgezeichneten Text so plakativ in Szene zu setzen. Bereits die Frankfurter Uraufführung vor einem Jahr schien an einem Übermaß des Klamauks zu kranken. Auch die Schweizer Erstaufführung in den Berner Vidmarhallen schmeißt sich den verführerischen Sätzen Zellers überschwänglich an den Hals. Diese sind aber selber schon Karikatur genug, reihen Worthülsen aneinander. So geschickt, kunstvoll und listig das Felicia Zeller in ihrem Text auch anstellt, eine gewisse Ermüdung beim Abspulen dieser modernen Litaneien bleibt unvermeidbar. Eine Unterfütterung der Textbausteine mit existenzieller Wahrheit hätte gerade bei diesem Stück Zellers not getan, da ihm die Ambivalenz ihres großartigen „Kaspar Häuser Meer“ fehlt.Den Zeitgeist packt es allerdings exakt beim Schopf. Weswegen den deutschsprachigen Theaterfreunden in naher Zukunft noch einige „X-Freunde“ in die Häuser stehen. Den inoffiziellen Wettbewerb um die beste Version wird wohl jene Inszenierung gewinnen, in welcher Holgers Tod am Schluss des Stücks den Zuschauern, anders als der lieblosen Gattin Anne, nicht einfach nur ungelegen kommt. About Ewa HessSwiss journalist, Editor Arts @Sonntagszeitung, ZürichView all posts by Ewa Hess » @askewa @PSPresseschau Wunderbares textlein 🍀 thx 4 sharing 08:10:37 PM Mai 30, 2023 von &s in Antwort auf PSPresseschau@GESDA Hackathon 4 the future – Open Quantum Institute in the making. Impressive! https://t.co/hWBdlsEFkd 09:35:19 AM Mai 07, 2023 von &s in Antwort auf GesdaIt’s my #Twitterversary! I have been on Twitter for 13 years, since 26 Nov 2009 (via @twi_age). 01:00:51 AM Dezember 13, 2022 von &s @askewa folgen Neueste Beiträge Baselitz‘ WeltI likePrivate Sales, ein SchattenspielAdieu John BergerTalk mit Jacqueline Burckhardt Blogroll FAQNews-BlogPop MattersRevue 21Support ForumWordPress-Planet Themen Ai Weiwei Amerika Andy Warhol Aphrodite Ascona Baron Heinrich Thyssen Basel Biennale Venedig Bird’s Nest Caravaggio China Fischli/Weiss Fondation Beyeler Frank Gehry Georg Baselitz Gerhard Richter Ghirlandaio Gstaad Gurlitt Gustav Klimt Harald Szeemann Keanu Reeves Kunst Kunstmuseum Basel Louise Bourgeois Maja Hoffmann Maria Lassnig Marlene Dumas Melinda Nadj Abonji Monte Verità Nachtkritik Oprah Winfrey Pipilotti Rist Schweizer Architektur Schweizer Film Schweizer Kunst Schweizer Literatur Shakespeare Simon de Pury Thomas Hirschhorn Ugo Rondinone Urs Fischer Valentin Carron Warhol Weltwoche Next Post Schreibe einen Kommentar Cancel Reply Logged in as Ewa Hess. Edit your profile. Log out? Required fields are marked * Message*