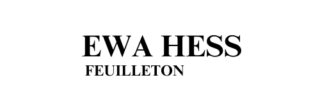Jean-Michel Basquiat
Jean-Michel Basquiat admin | 2. Mai 2010 – 15:41 von Ewa Hess Zwanzig Jahre vor der Wahl Barack Obamas zum ersten dunkelhäutigen Präsidenten der Vereinigten Staaten stirbt Jean- Michel Basquiat 27-jährig an einer Überdosis Heroin. Seine Mutter ist Puerto Ricanerin, sein Vater stammt aus Haiti. Ihr charismatisches Kind hinterlässt 1988 trotz seines frühen Todes ein künstlerisches Werk, dessen sich ein 90-Jähriger nicht zu schämen bräuchte. In nur acht Jahren hat der rastlose Autodidakt 900 Gemälde, 1250 Zeichnungen geschaffen. Von den kleinen, konzeptuellen Arbeiten des Anfangs über die kreative Explosion der mittleren Jahre bis zu den melancholischen späten Gemälden ist in diesem Werk mehr enthalten, als in einem menschlichen Kopf überhaupt Platz zu haben scheint.Zwei Köpfe, «Dos cabezas», nannte Basquiat jenes Bild, mit dem er sich die Freundschaft des grossen Andy Warhol erwarb. Während einer gemeinsamen Fotosession stahl er sich davon und schickte Warhol wenig später das noch feuchte Gemälde. Zwei Köpfe waren drauf: Andy undJean-Michel. Der Kaiser der Pop- Art und der König des Downtown Manhattan. «Der ist schneller als ich!», beklagte sich Warhol bei Bruno Bischofberger. Der Schweizer Galerist hatte den 32 Jahre jüngeren Basquiat bereits unter Vertrag . 1978, als Jean-Michel Basquiat aus Brooklyn, wo er aufwuchs, auf die andere Flussseite kam, um sich dem Kunstvolk anzuschliessen, war New York eine Stadt im Ausnahmezustand. Ökonomisch pleite, beherrscht von Kriminalität, wurde Manhattan zu einer Art Freibeuterzone. Wer keine Angst hatte vor den Drogendealern, wer den billigen Wohnraum schätzte und feste Anstellungsverhältnisse verachtete, gedieh in diesem Biotop. Künstler, Filmemacher, Musiker trafen sich allnächtlich in den NewWaveLokalen wie dem Mudd Club oder dem Club 57. Bald war JeanMichel mit seinem unverwechselbaren Tanzstil ein festes Mitglied der DowntownClique, zu der auch Keith Haring, David Byrne, Debbie Harry, John Lurie oder Madonna gehörten. Eine Affäre mit Madonna blieb unvergesslich – für sie Mit der «Like A Virgin»Sängerin turtelte er kurz herum – sie spricht bis heute davon. Sie war nicht die einzige. Für Mädchen war der sanft lächelnde, intensiv blickende, zart empfindende Jean so gut wie unwiderstehlich. Und wie es sich bald schon herausstellen sollte – für Kunsthändler galt das Gleiche. Er fing als Graffitikünstler an. Doch während bei den anderen Strassenkünstlern das Ornament im Vordergrund stand, schrieb Basquiat poetische Sätze an die Wände des Galerienquartiers. 1980 nahm er bereits an der «Times Square Show» teil, zusammen mit Jenny Holzer. Doch es ist erst die von Diego Cortez organisierte «New York, New Wave»Ausstellung 1981, die ihn schlagartig berühmt macht. Im Dokumentarfilm «The Radiant Child» (er wird im Rahmen der Ausstellung in der Fondation Beyeler gezeigt) erwacht Basquiat mit seinem rätselhaften Lächeln und dem schmelzenden Honigblick nochmals zum Leben. Man hört auch seine erste Galeristin Annina Nosei, wie sie sich wehmütig nochmals darüber ärgert, dass ihr Schützling damals so laut Musik hörte, die ganze Nacht lang: Ravels Bolero. Immer und immer wieder. «Quiet there!», klopfte sie mit dem Regenschirm. Nosei liess Basquiat im Atelier unter der Galerie arbeiten. Nebst den Leinwänden bemalte er alles, was ihm im Weg stand – Türen, Fenster, Kühlschränke, Teller. Er konnte alles, was ihm begegnete, in rasender Geschwindigkeit in Kunst verwandeln. In seinen Bildern bringt er mühelos westliches Bildungsgut, Versatzstücke der Strassenkultur und haitianische Spiritualität zusammen. Wären seine Bilder Musik, würde man vom Sampling reden. Seine erste Einzelausstellung ist am ersten Abend ausverkauft. Plötzlich ist er reich. «New Art, New Money» titelt die «New York Times». Basquiat sitzt auf dem Titelbild des Magazins barfuss, in einem farbverschmierten Designer-Anzug. Freunde berichten von Geldbündeln, die in seiner Wohnung verstreut herumlagen, während der Hausherr JahrgangChampagner entkorkte. Vielleicht war es dieser gefährliche Lebensstil, der den frühen Tod des Künstler verschuldet hat. Seiner Kunst konnte er nichts anhaben. Jedes dieser Bilder trifft mitten ins Herz und lässt auch den Kopf nicht unbeteiligt. Die Schau in der Fondation Beyeler wird die schönsten und wichtigsten versammeln. Allein schon die Leihgeberliste liest sich wie ein Who’s who der Inspirierten, Berühmten, Reichen, Klugen. Vom Rockstar über den Kunsthistoriker bis zum Wirtschafts tycoon: Basquiats Bilder haben jedem Sammler etwas zu sagen. Sie erzählen auch jedem, der sie anschaut, bedeutungsvolle Geschichten. Und was noch erstaunlicher ist: Mit jedem Jahr, das seit seinem Tod verstreicht, werden diese Geschichten reicher. «Basquiat», 9. 5. – 5. 9. in der Fondation Beyeler in Riehen @askewa @PSPresseschau Wunderbares textlein 🍀 thx 4 sharing 08:10:37 PM Mai 30, 2023 von &s in Antwort auf PSPresseschau@GESDA Hackathon 4 the future – Open Quantum Institute in the making. Impressive! https://t.co/hWBdlsEFkd 09:35:19 AM Mai 07, 2023 von &s in Antwort auf GesdaIt’s my #Twitterversary! I have been on Twitter for 13 years, since 26 Nov 2009 (via @twi_age). 01:00:51 AM Dezember 13, 2022 von &s @askewa folgen Neueste Beiträge Baselitz‘ WeltI likePrivate Sales, ein SchattenspielAdieu John BergerTalk mit Jacqueline Burckhardt Blogroll FAQNews-BlogPop MattersRevue 21Support ForumWordPress-Planet Themen Ai Weiwei Amerika Andy Warhol Aphrodite Ascona Baron Heinrich Thyssen Basel Biennale Venedig Bird’s Nest Caravaggio China Fischli/Weiss Fondation Beyeler Frank Gehry Georg Baselitz Gerhard Richter Ghirlandaio Gstaad Gurlitt Gustav Klimt Harald Szeemann Keanu Reeves Kunst Kunstmuseum Basel Louise Bourgeois Maja Hoffmann Maria Lassnig Marlene Dumas Melinda Nadj Abonji Monte Verità Nachtkritik Oprah Winfrey Pipilotti Rist Schweizer Architektur Schweizer Film Schweizer Kunst Schweizer Literatur Shakespeare Simon de Pury Thomas Hirschhorn Ugo Rondinone Urs Fischer Valentin Carron Warhol Weltwoche Next Post Schreibe einen Kommentar Cancel Reply Logged in as Ewa Hess. Edit your profile. Log out? Required fields are marked * Message*
Jean-Michel Basquiat Read More »