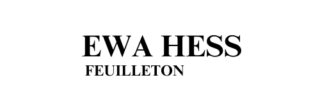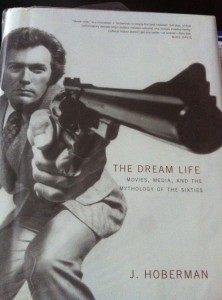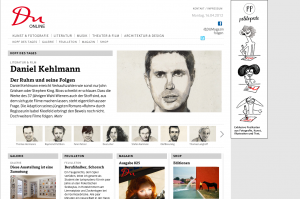Mike Kelley
Mike Kelley Ewa Hess | 2. Februar 2012 – 08:49 Heute erreicht uns die Nachricht, dass Mike Kelley sich am Dienstag Abend in seiner Wohnung in einem Vorort von Los Angeles das Leben nahm. Vor 12 Jahren führte ich mit ihm ein Interview in Zürich, in dem er sich dem heutigen Kunstbetrieb gegenüber sehr desillusioniert zeigte. Seine Freunde wie Tony Oursler berichten, dass seine Depression ihn immer isolierter machte. Er fühlte sich früher als Nonkonformist wohler als später als der Star, der er geworden war. Sein Einfluss auf die Kunst von heute bleibt enorm. Hier ist das Interview von damals (SonntagsZeitung / Kultur / 2. April 2000):VON EWA HESS Der in Los Angeles wirkende Mike Kelley, ein wichtiger amerikanischer Künstler der Gegenwart, widmet seine Werke oft kontroversen Inhalten und inszeniert scheinbar banale Objekte, um verborgene Inhalte freizulegen. In seiner Ausstellung im Migros Museum in Zürich, die am 7. April eröffnet wird und bis am 4. Juni 2000 dauert, baute er unter anderem eine Touristenattraktion aus dem Chinatown von LA nach: einen «Wunschbrunnen», eine grell bemalte fantastische Miniaturlandschaft voller Grotten, Figuren und Symbole. Vor seiner Ausstellung in Zürich spricht Mike Kelley über Kunst und Kommerz. Mike Kelley, besteht Ihre Ausstellung nur aus Käfigen? Es geht mir weniger um Käfige als um Rahmen – oder Zäune. Ich habe einen chinesischen Brunnen und den Zaun drumherum nachgebaut. Und dann den Brunnen wieder herausgenommen. Kelley: Wenn man den Brunnen mit dem Zaun sieht, ist der Zaun unsichtbar. Ich stelle den Brunnen und seinen Zaun separat aus und gebe den beiden Objekten ihre Individualität zurück. Warum haben Sie diesen Brunnen überhaupt nachgebaut? Kelley: Weil er eine aufregende öffentliche Skulptur ist. Dabei sieht er ganz anders aus – wie eine Landschaft. Oder wie etwas Organisches. Ich beschäftige mich in der letzten Zeit viel mit den öffentlichen Skulpturen. Was fasziniert Sie dabei? Kelley: Die Frage der Form und der Formlosigkeit. Wo hört das Chaos auf, wo fängt die Form an? Ihre eigene Biografie interessiert Sie nicht mehr? Sie haben als einer der Ersten die Kindheit zum Thema der Kunst gemacht. Kelley: Die feministischen Künstlerinnen waren vor mir. Doch mein Interesse ist anders geartet. Ich habe mich von Anfang an mehr für die allgemeingültige Mythologie interessiert und weniger für den konkreten individuellen Werdegang. Ihre Stofftier-Installationen Anfang der Neunzigerjahre haben Aufsehen erregt. Waren damit keine persönlichen Kindheitserinnerungen verbunden? Kelley: Nein. Damals, in den späten Achtzigerjahren, drehte sich die Diskussion um den Warencharakter der Kunst. Ich dachte an Waren, an Geschenke. Teddybären sind ideale Geschenke. Teddybären, die zu Knäueln zusammengepappt sind oder von nackten Menschen angesprungen werden, wecken andere Assoziationen. Kelley: Natürlich dachten sofort alle, dass es um Szenarien eines Kindsmiss-brauchs geht. Das habe ich nicht beabsichtigt. Aber dann habe ich das Thema aufgenommen. Warum wurde es überhaupt zum Thema? Kelley: Weil unsere Zeit auf Kindsmiss-brauch fixiert ist. Egal was man macht, die Leute sehen Kindsmissbrauch darin. Sie schauen die Kunst gar nicht an, 99 Prozent aller Menschen sind visuelle Analphabeten. Sie haben bestimmt eine Vermutung, weshalb das Thema des Kindsmissbrauchs unsere Zeit so beherrscht? Kelley: In Amerika hängt das mit dem politischen Aufstieg der christlichen Rechten zusammen. Und wie? Kelley: Weil diese politischen Kreise die Fantasie der kindlichen Unschuld unterstützen und fördern. In dieser Atmosphäre kommt es schneller zu Hexenverfolgungen. Und die Kindsmissbrauch-Hysterie hat etwas von einer mittelalterlichen Hexenverfolgung. Sehen Sie sich als Vorläufer der heutigen Kunstszene, etwa der jungen britischen Künstler, deren Ausstellung «Sensation» sowohl in London wie in New York mit Verboten zu kämpfen hat? Kelley: Die britischen Künstler sind ein neues Phänomen. Meine Generation der Künstler, zu der auch Jim Shaw oder Tony Oursler gehören, kennt dieses Ausmass des Marktinteresses gar nicht. Wir wurden nicht mit dem gleichen Fieber gesammelt, gekauft und ausgestellt. Dabei wurzelt die heutige Auffassung der Kunst stark in dem, was Sie machen. Kelley: Die jungen Künstler arbeiten auf einer ganz anderen Grundlage als wir: Für sie existiert der Unterschied zwischen der Hochkultur und der Populärkultur gar nicht mehr. Die Frage, woher die Kunst schöpft, stellt sich ihnen gar nicht erst. Die Kunst darf heute alles integrieren, Kitsch, Werbung, Kunstgeschichte. Alles ist gleichwertig. Zu diesem Phänomen haben Sie mit Ihrem Werk auch beigetragen. Kelley: Ja. Doch unsere Auseinandersetzungen waren komplexer. Auch die Kunstkritik war ernsthafter. Haben Sie jemals etwas wirklich Tiefes über die BritArt gelesen? Tja… Kelley: Natürlich nicht. Die Kritiker versuchen nicht einmal, die Unterschiede zwischen den einzelnen Künstlern dieser Gruppe herauszuarbeiten. Es ist ein Modetrend. Worin liegt der Unterschied zwischen denen und Ihnen? Kelley: Die Arbeiten der jungen Künstler heute sind in hohem Masse unpsychologisch. Sie beschäftigen sich nicht mit dem menschlichen Drama, sondern mit der Oberfläche der Dinge. Wohin führt diese Entwicklung? Kelley: Ich war immer interessiert an den soziopolitischen Inhalten der Kunst. Wenn ich jetzt sehe, wie die Kunst und die Populärkultur zusammenkommen, fürchte ich, dass die Kunst in dieser Fusion der schwächere Partner ist. Sie wird verlieren. Indem sie mit der Modeindus-trie verschmilzt, verliert die Kunst ihre kritische Kraft. Wird sie ihre kritische Kraft wiedergewinnen? Kelley: Sie wird. Wenn das Geld mal abfliesst, wird die Kunst zur Besinnung kommen. Wann wird das sein? Kelley: In der nächsten Generation. Das heisst in fünf Jahren. Kelley: Ja, heute dauern Kunst-Generationen fünf Jahre. Früher warens zwanzig. Dann können Sie mit Ihrer Fähigkeit zur kritischen Auseinandersetzung der nächsten Generation helfen. Kelley: Ach was. Man hilft niemandem in der Kunst. Jeder muss sich selber helfen. «Indem sie mit der Modeindustrie verschmilzt, verliert die Kunst ihre kritische Kraft»: Mike Kelley About Ewa HessSwiss journalist, Editor Arts @Sonntagszeitung, ZürichView all posts by Ewa Hess » @askewa @PSPresseschau Wunderbares textlein 🍀 thx 4 sharing 08:10:37 PM Mai 30, 2023 von &s in Antwort auf PSPresseschau@GESDA Hackathon 4 the future – Open Quantum Institute in the making. Impressive! https://t.co/hWBdlsEFkd 09:35:19 AM Mai 07, 2023 von &s in Antwort auf GesdaIt’s my #Twitterversary! I have been on Twitter for 13 years, since 26 Nov 2009 (via @twi_age). 01:00:51 AM Dezember 13, 2022 von &s @askewa folgen Neueste Beiträge Baselitz‘ WeltI likePrivate Sales, ein SchattenspielAdieu John BergerTalk mit