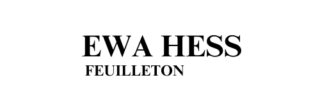Richard Gere in Zürich Ewa Hess | 20. September 2012 – 14:02 Das Gespräch mit Richard Gere führte ich im Vorfeld seines Besuchs in Zürich, wo er einen Preis des Zurich Film Festival bekommt. Er rief mich an aus Westchester, NY. Danke für den Anruf, Mister Gere. Absolutely! Zürich freut sich auf Ihren Besuch – mögen Sie die Stadt? Ja, früher war ich öfter da, aber jetzt schon lange nicht mehr. Das letzte Mal war ich hier auf dem Weg nach Kosovo, als ich ein Flüchtlingslager dort besucht habe. Das muss 1999 gewesen sein. Was brachte Sie jeweils in die Schweiz? Einerseits die Kunst, andererseits Tibet. Die Schweiz hat unseren tibetischen Brüdern und Schwestern viel Freundlichkeit erwiesen. Das erste Mal war ich in der Schweiz, um seine Heiligkeit den Dalai Lama in Rikon lehren zu hören. Aber ich hatte in Zürich auch einen guten Freund, den inzwischen verstorbenen Galeristen Thomas Ammann. Für Sie ist die Schweiz also nicht das Land, in dem man vor allem Banken besucht? Nein. Ich habe hier noch nie eine Bank besucht. Auch nicht, um sich auf den Film «Arbitrage» vorzubereiten? Dafür brauche ich mich doch nicht mit dem Finanzwesen zu beschäftigen! Mein Metier ist es, Gefühle wiederzugeben. Ich interessiere mich für die Ethik und das Verantwortungsgefühl, die in jedem Menschen schlummern. Auch in der Welt des Geldes sollten diese Empfindungen bestimmend sein. Sie sind es aber nicht, wie wir alle wissen. Das Problem ist die Gier. Geldverdienen gehört zum Leben dazu, aber das Ausmass hat sich verschoben. Es ist nie genug. Sie schaffen es locker, einen skrupellosen Geschäftsmann sympathisch wiederzugeben. Fanden Sie meine Figur im Film sympathisch? Na, dann ist es mir ja wieder einmal gelungen. Moralisch korrupte Typen sympathisch rüberzubringen, ist wohl einer der Tricks, die ich als Schauspieler wirklich gut beherrsche. Ich weiss nicht, ob ich darauf stolz sein soll oder nicht. Der Geschäftsmann Edward Lewis in «Pretty Woman» ist im Grunde auch ein moralisches Monster … Und solche sind in der echten Welt für gewöhnlich sehr charmant, ist es nicht auch Ihre Erfahrung? Ich bin mir nicht sicher, ob ich schon einen getroffen habe … Ja, Monster ist ein starkes Wort. Aber ich meine Menschen, von denen man weiss, dass sie schlimme Dinge verbrochen haben. Und dann trifft man sie, und es stellt sich heraus, dass sie ein Herz für ihre Familien haben und unversehens werden sie einem sympathisch. Das geht ganz schnell. Haben Sie schon Monster getroffen? Mir sind ziemlich schlechte Menschen über den Weg gelaufen, glauben Sie mir. Ich will aber keine Namen nennen, weil ich denke, dass sich jeder bessern kann. In «Pretty Woman» gab es eine Bekehrung. Ein Happy End wärmt das Herz, die interessante Aussage des Films «Arbitrage» ist aber, dass jeder auf seine eigene Weise moralisch korrupt ist und es auch bleibt. Keine Figur dieses Films ist souverän. Jeder verrät seine Ideale. Eine starke Anklage unserer Welt. Ja, wir haben uns zu weit von der Dorfgemeinschaft entfernt, in der wir einst gelebt haben. In einem Dorf kennt man sich, man trägt einander Sorge, in einem Dorf sind dem masslosen Egoismus natürliche Grenzen gesetzt. Stimmt das, dass Sie seinerzeit die Rolle des Gordon Gekko in «Wall Street» abgelehnt haben? Da gab es tatsächlich Gespräche. Doch dann kam es nicht zustande, ich weiss nicht mehr warum, es ist schon eine Weile her. Exakt 25 Jahre. Und die Entgleisungen, die der Film karikiert, gibt es immer noch. Das stimmt. Ich dachte eigentlich, dass die Wirtschaftskrise unsere Rettung sein wird, dass man das ganze System neu denkt. Aber die Verantwortungslosigkeit hat überlebt und ist wieder daran, die Kontrolle zu übernehmen. Wie wählen Sie Ihre Rollen? Ich entscheide danach, ob mich etwas im Drehbuch berührt. Können Sie «Pretty Woman» noch sehen? Natürlich! Ich liebe den Film. Haben Sie nicht genug davon, ständig mit dieser Rolle identifiziert zu werden? Ich habe in über 50 Filmen gespielt, die einen sind populärer, die anderen weniger. So what? Julia Roberts, Diane Lane, Catherine Zeta-Jones: gibt es noch eine schöne Frau, an deren Seite Sie noch nicht gespielt haben? Ich weiss nicht. Aber ich sehe das auch als ein Glück an, mit vielen schönen Schauspielerinnen vor der Kamera stehen zu dürfen. Im aktuellen Film ist Susan Sarandon Ihre Gattin und Laetitia Casta die Geliebte. Nicht schlecht, oder? Susan ist eine alte Freundin und es ist der zweite Film, den wir zusammen machen. Laetitia aber kenne ich schon seit sie ein Teenager war. Wie kommt das? Sie hat für einen meiner engsten Freunde gemodelt. Für den berühmten Fotografen Herb Ritts? Ja, er war mein Jugendfreund. Der Gedanke an seinen frühen Tod 2002 macht mich immer noch traurig. Stimmt es, dass er dank einem Porträt-Foto von Ihnen überhaupt berühmt wurde? Da ist etwas daran. Damals, in den 70er-Jahren, hofften wir, unseren Weg zu machen – ich als Schauspieler, er als Fotograf. Eine Porträtserie hat unsere beiden Karrieren befördert. Wir blieben Freunde, und es war er, durch den ich Laetitia kennen gelernt habe. Ich glaube, dass Herb sie entdeckt hat. Haben Sie sie für die Rolle in «Arbitrage» vorgeschlagen? Ich zeigte dem Regisseur den Film über Serge Gainsbourg, in dem sie Brigitte Bardot spielt. Da hat sie dieses französische Flair, alle waren begeistert. Ihre Stiftung Gere Foundation unterstützt humanitäre Anliegen. Entspringt Ihre Wohltätigkeit Ihrembuddhistischen Glauben? Nicht nur. Meinen Sinn für gemeinschaftliche Verantwortung habe ich auch von meinem Vater geerbt. Zudem liegt die Idee der persönlichen Verantwortung, die der Dalai Lama lehrt, auch jeder wahren Demokratie zugrunde. Wann ist Ihr spirituelles Interesse in ein politisches Engagement für Tibet umgeschlagen? Es war 1986 in Bodhgaya. Ich kam nach Indien, um hier belehrt zu werden. Es war damals gar nicht so einfach, zu diesem heiligen Ort, wo Buddha Erleuchtung fand, zu gelangen. Als ich ankam, sagte man mir, dass der Dalai Lama mit mir sprechen wollte. Er sagte: Wir sind auf Freunde aus dem Ausland angewiesen. Wirst du uns helfen? Und ich sagte: Selbstverständlich. Dass Sie sich für Tibet engagieren, hat Ihnen auch schon Schwierigkeiten eingebracht. Ich darf in China nicht